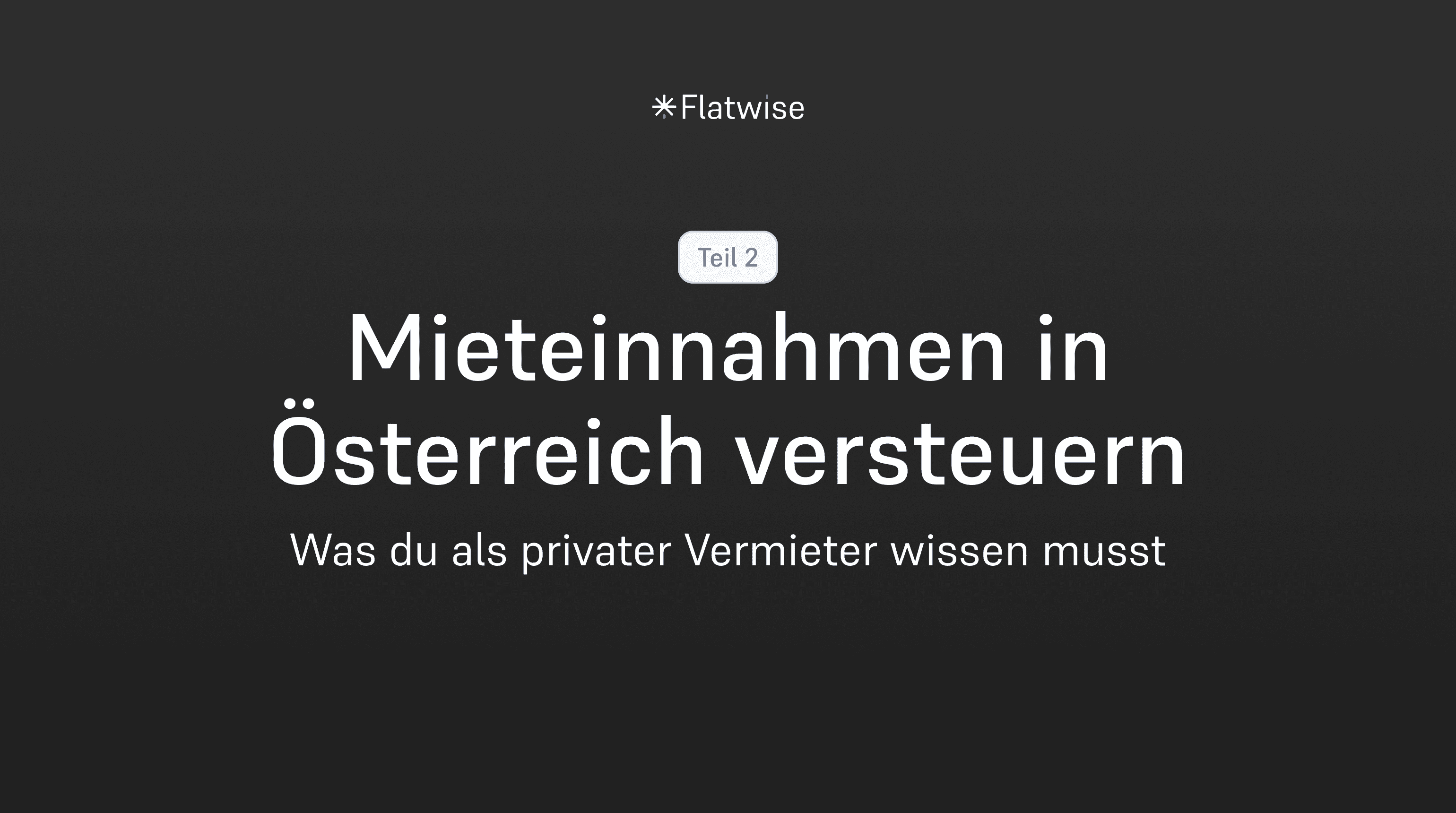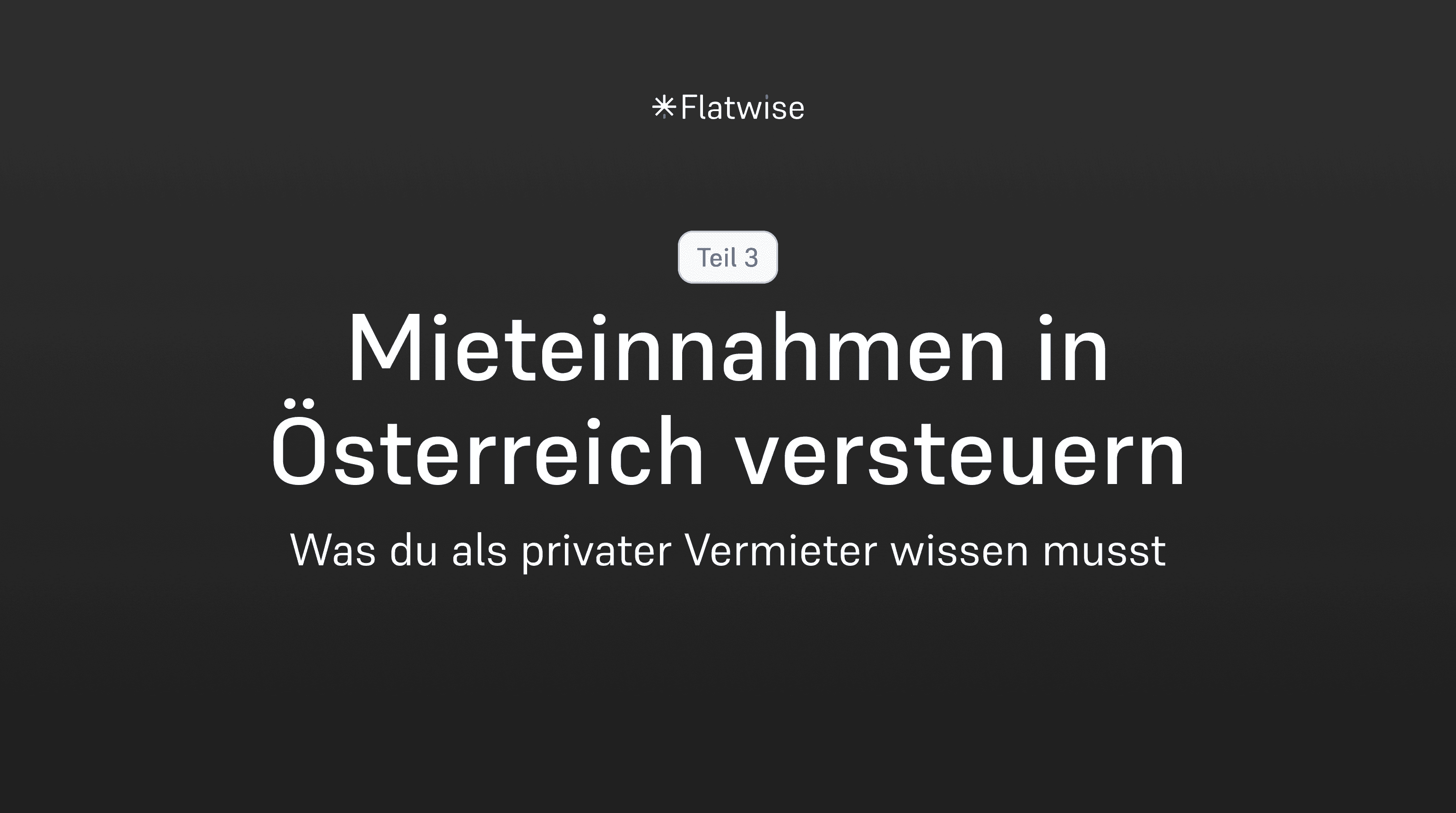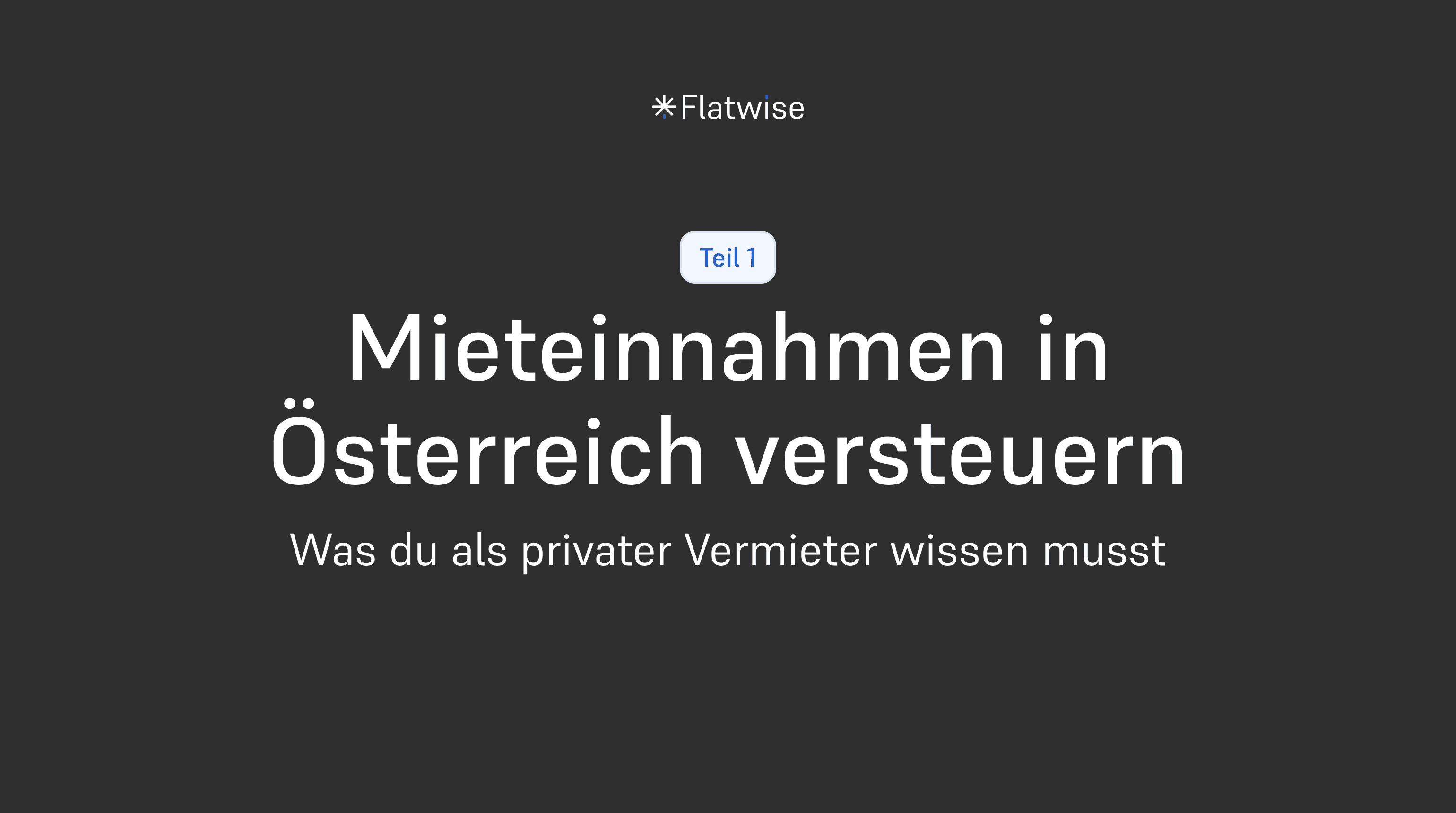Steuern
Teil 2: Mieteinnahmen in Österreich versteuern für Vermieter
Was darfst du abschreiben? Wie funktioniert die AfA? Und was ist steuerlich absetzbar? Der Leitfaden für Vermieter zu Mieteinnahmen und Steuern in Österreich.
Im ersten Teil dieser Serie hast du die steuerlichen Grundlagen der Vermietung kennengelernt, angefangen bei der Versteuerung von Mieteinnahmen und Anrechnung von Werbungskosten bis zur Liebhabereiregelung. Nun geht es um die vertiefende Anwendung von zentralen Aspekten wie der AfA und der Unterscheidung zwischen Herstellungsaufwand und Erhaltungsaufwand für dich als Vermieter:in mit Immobilien im Privatvermögen. Welche Rolle spielt die Abschreibung (AfA) im Zusammenhang mit der Besteuerung? Welche Investitionen darfst du wie absetzen? Und wann handelt es sich bei er geplanten Maßnahme um eine Instandhaltung, wann um eine Herstellung?
Abschreibung (AfA) verständlich erklärt
Wenn du als Vermieter:in eine Immobilie im Privatvermögen hältst und daraus Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielst, spielt die sogenannte Absetzung für Abnutzung. meist kurz „AfA“ genannt, eine zentrale Rolle in deiner steuerlichen Planung. Die AfA ist für dich eine der wichtigsten Möglichkeiten, um deine steuerpflichtigen Mieteinnahmen zu reduzieren, denn damit wird der Wertverlust des Gebäudes über einen längeren Zeitraum hinweg steuerlich geltend gemacht. Es handelt sich bei der AfA um eine planmäßige, gesetzlich verankerte Absetzung (§ 28 EStG), die, im Falle der Vermietung, durch die Einnahmen-Werbungskosten-Überschussrechnung im Rahmen der dort erfassten Werbungskosten erfolgt.
Was viele Vermieter:innen nicht wissen ist, dass nicht der gesamte Kaufpreis einer Immobilie abgeschrieben werden darf, denn der Grundanteil ist nicht abschreibbar, nur der Gebäudeanteil. Das macht eine korrekte Aufteilung nach bestimmten Richtlinien zwingend erforderlich.
Grundlagen zur AfA und was abgeschrieben werden darf
Zunächst ist wichtig zu verstehen, dass nicht der gesamte Kaufpreis einer Immobilie abgeschrieben werden kann. Es wird immer zwischen dem Gebäudeanteil und dem Grundanteil unterschieden. Der Gebäudeanteil unterliegt der Abnutzung und kann daher abgeschrieben werden, während der Grund und Boden keiner Abnutzung unterliegt und somit nicht abschreibbar ist. Die AfA erlaubt dir, die Anschaffungskosten des Gebäudes über einen längeren Zeitraum abzuschreiben. Damit sollen der natürliche Verschleiß und die Abnutzung der Immobilie steuerlich abgebildet werden. In der Praxis bedeutet das, ein Teil der Kosten, die du beim Kauf getragen hast, wird dir jährlich in Form eines steuermindernden Betrags anerkannt. Für privat vermietete Wohngebäude im Privatvermögen beträgt die lineare AfA in der Regel 1,5 % jährlich des auf das Gebäude entfallenden Kaufpreises, das entspricht der festgesetzten Nutzungsdauer von ca. 67 Jahren.
Der Abschreibungszeitraum beginnt grundsätzlich mit dem Monat, in dem das Gebäude erstmals der Einkünfteerzielung dient, also in der Regel mit dem Beginn der tatsächlichen Vermietung. Bei unterjährigem Vermietungsbeginn wird der Jahres-AfA-Betrag aliquot angesetzt (z. B. 6/12 bei Vermietungsbeginn im Juli).
Tipp: Wenn möglich, starte die Vermietung zu Monatsbeginn, denn so sicherst du dir den AfA-Abzug für den vollen Monat.
Auch zu beachten gilt, dass die Anschaffungsnebenkosten die AfA-Bemessungsgrundlage erhöhen. Die AfA-Bemessungsgrundlage umfasst nicht nur den reinen Kaufpreis des Gebäudes, sondern auch anteilig die Anschaffungsnebenkosten, soweit sie auf das Gebäude entfallen. Dazu zählen unter anderem:
Maklerprovision
Notarkosten und Vertragserrichtung
Grunderwerbsteuer (GrESt)
Eintragungsgebühren beim Grundbuch
Diese Kosten erhöhen den abschreibbaren Betrag, sofern sie sachgerecht dem Gebäude zugeordnet werden können. Auch hier ist eine korrekte Aufteilung zwischen Gebäude und Grund erforderlich und zur Ermittlung der anzusetzenden AfA entscheidend.
Die rechtliche Grundlage für die steuerlich zulässige Aufteilung zwischen Gebäude- und Grundanteil bildet die sogenannte Grundanteilverordnung 2016 in Verbindung mit dem EStG. Diese Verordnung legt pauschale Aufteilungswerte fest, die je nach Lage und Nutzung der Immobilie unterschiedlich hoch ausfallen. Wie eingangs bereis erwähnt, liegt der Satz der AfA aber in der Regel bei 1,5% pa.
Beispielrechnung zur AfA:
Du kaufst eine Wohnung um 200.000 Euro. Davon entfallen laut Kaufvertrag oder Schätzung 140.000 Euro auf das Gebäude. Deine jährliche Abschreibung beträgt:
1,5 % von 140.000 € = 2.100 Euro (siehe auch Beispiel Herr Meier).
Ermittlung des Gebäudeanteils
Die Aufteilung zwischen Gebäude und Grund beeinflusst unmittelbar den Abschreibungsbetrag, den du jährlich steuerlich geltend machen kannst. Wird der Grundanteil zu hoch angenommen, reduziert sich die AfA-Bemessungsgrundlage und damit auch dein steuerlich absetzbarer Betrag. Eine fehlerhafte oder unrealistische Aufteilung kann zu Nachforderungen durch das Finanzamt führen oder im Fall einer Prüfung beanstandet werden. In der untenstehenden Grafik kannst du die pauschalen Richtwerte der aktuellen Grundanteilsverordnung entnehmen.
Diese pauschalen Sätze sind sowohl für dich als auch die Finanzbehörden verbindlich, sofern nicht nachgewiesen wird, dass sie im Einzelfall deutlich von den tatsächlichen Verhältnissen abweichen.
In Ballungsräumen oder Großstädten kann der Grundanteil laut Finanzamt auch bis zu 70 % betragen, was die AfA entsprechend reduziert.
D.h. sowohl du als Vermieter:in als auch das Finanzamt können von den Pauschalwerten der Verordnung abweichen, jedoch nur, wenn ein qualifizierter Nachweis erbracht wird. Ein Schätzgutachten eines Sachverständigen muss belegen, dass der tatsächliche Grundanteil erheblich vom Pauschalwert abweicht, gemeint ist damit in der Regel eine Abweichung von mehr als 50 %. Ohne solchen Nachweis bleibt die Aufteilung nach den gesetzlichen Pauschalsätzen bindend. Diese Regelungen gelten ebenso für bereits gekaufte Immobilien.
Tipp: Im Kaufvertrag sollte die Aufteilung zwischen Gebäude und Grund sachlich begründet und realistisch angegeben sein. Finanzämter akzeptieren Schätzgutachten, aber keine rein fiktiven Aufteilungen.
Sonderformen der Abschreibung bei Altbauten, Klimaaktivität, Eigennutzung
Neben der standardmäßigen linearen Abschreibung (AfA) von 1,5 % jährlich gibt es für bestimmte Konstellationen abweichende oder ergänzende Regelungen, die du als Vermieter:in aus kennen solltest. Diese betreffen insbesondere Altbauten, klimaaktive Neubauten, teilweise Eigennutzung, sowie die AfA bei erstmaliger Vermietung oder nach unentgeltlichem Erwerb. Diese Sonderformen weichen in den anzuwendenden AfA-Sätzen, der damit verbundenen Nutzungsdauer oder aber auch dem anzusetzenden Wert von der zuvor erklärten üblichen Berechnungsmethode ab.
Sonderform bei Altbauten
Für Gebäude, die vor dem Jahr 1915 errichtet wurden, kannst du einen AfA-Satz von 2,0 % pro Jahr anwenden (§ 8 EStG). Du musst dafür keine gesonderte verkürzte Nutzungsdauer nachweisen, jedoch ist der Bauzeitpunkt nachvollziehbar zu dokumentieren. Dies gelingt etwa durch einen Grundbuchauszug, Bauakt oder eine zeitgenaue Immobilienbewertung. Diese Regelung gilt ausschließlich für Gebäude im Privatvermögen, nicht für betriebliche Immobilien.
Beschleunigte AfA für klimaaktive Neubauten
Für zwischen 01. Jänner 2024 und 31. Dezember 2026 fertiggestellte Gebäude, die dem sogenannten „klimaaktiv-Standard Bronze“ entsprechen, kann in den ersten Jahren eine beschleunigte Abschreibung erfolgen. Aktuell erlaubt das Steuerrecht folgenden gestaffelten Abschreibungsverlauf über 15 Jahre:
Jahr 1: 4,5 % jährlich
Jahr 2: 3,0 % jährlich
Jahr 3: 1,5 % jährlich
Diese Regelung soll energetisch nachhaltige Neubauten fördern. Voraussetzung ist, dass der Bau den aktuellen klimaaktiven Förderkriterien des Bundes (BMK) entspricht. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Vorlage entsprechender Nachweise wie einer klimaaktiv-Zertifizierung.
AfA bei teilweiser Eigennutzung
Wenn du eine Immobilie teilweise selbst nutzt und teilweise vermietest, darfst du die Abschreibung nur anteilig für jenen Teil geltend machen, der tatsächlich vermietet wird. Grundlage für die anteilige AfA ist eine präzise Flächenaufteilung, z. B. anhand eines präzisen und fachmännisch erstellten Grundrisses. Ebenso sind nur die anteiligen Werbungskosten (z. B. Zinsen, Instandhaltung) absetzbar.
Besondere Vorsicht gilt bei Miteigentumsgemeinschaften mit nahen Angehörigen, denn die Finanzbehörde prüft bei der Vermietung an Ehepartner:innen oder unterhaltsberechtigte Kinder besonders streng, ob ein fremdübliches Mietverhältnis vorliegt (BAO). In der Regel wird hier keine Einkunftsquelle anerkannt, damit sind weder AfA noch Werbungskosten abziehbar.
Abschreibung bei erstmaliger Vermietung
Beginnt die Vermietung eines Gebäudes erstmals, so startet die AfA grundsätzlich mit dem Monat der erstmaligen Nutzung zur Einkünfteerzielung. Wird eine Wohnung z. B. im Juli erstmals vermietet, darf für dieses Jahr nur 6/12 des Jahresbetrags abgeschrieben werden. Die Bemessungsgrundlage ist in diesem Fall nicht der ursprüngliche Kaufpreis, sondern der gemeine Wert (Verkehrswert) der Immobilie zum Zeitpunkt des Nutzungswechsels. Eine rückwirkende Abschreibung für die Eigennutzungszeit ist nicht möglich. Dies gilt allerdings nur, wenn zuvor kein entgeltlicher Erwerb mit bereits steuerlich relevanter Anschaffungsbasis vorlag, etwa im Fall einer unentgeltlichen Übertragung (z.B. Schenkung). Wurde die Immobilie hingegen zuvor entgeltlich erworben, etwa gekauft, gelten weiterhin die damaligen Anschaffungskosten als AfA-Bemessungsgrundlage, selbst wenn zwischenzeitlich eine Eigennutzung erfolgte.
Wichtig: Einbauten, Möblierungen oder Inserate vor Mietbeginn rechtfertigen noch keine AfA. Es zählt der tatsächliche Beginn des Mietverhältnisses.
Unentgeltlicher Erwerb und fiktive Anschaffungskosten
Wird eine Immobilie durch Erbschaft oder Schenkung erworben und danach erstmals vermietet, stellt sich die Frage nach der richtigen Abschreibungsbasis. Für sogenannte Altvermögen (vor 1.4.2002) können unter bestimmten Voraussetzungen fiktive Anschaffungskosten als AfA-Basis herangezogen werden z. B. ein Verkehrswertgutachten zum Zeitpunkt der erstmaligen Vermietung.
Das ist laut Finanz dann zulässig, wenn:
der Rechtsvorgänger die Vermietung mehr als 10 Jahre vor Vermietungsbeginn durch dich beendet hat, oder
du ein Mietverhältnis des Rechtsvorgängers kündigst und die Kündigung innerhalb von 3 Monaten nach Einantwortung oder Schenkungsannahme erfolgt.
In diesem Fall gelten geteilte Besteuerungsregeln bei einem späteren Verkauf:
Der Teil des Gewinns, der sich auf die „alten stillen Reserven“ bezieht, wird mit 4,2 % ImmoESt pauschal besteuert.
Der Teil des Gewinns ab Vermietungsbeginn unterliegt der regulären ImmoESt von 30 %.
Bei Unsicherheit über die anzuwenden Regeln empfiehlt sich ein Steuerberater oder ein sogenanntes verbindliches Auskunftsersuchen (Ruling) beim BMF.
Dazu erfährst du aber im nächsten Artikel mehr, denn dort erklären wir dir, wie sich die Immobilienertragssteuer (ImmoESt) errechnet.
Die richtige Nutzung der AfA und ihre wirtschaftliche Bedeutung
Die AfA ist weit mehr als nur ein steuerlicher Pflichtposten, denn sie ist eines der wenigen aktiven Instrument zur langfristigen Steueroptimierung für dich als Vermieter:in. Ob Altbau, klimaaktiver Neubau, Teilvermietung oder unentgeltlicher Erwerb, wenn du die Besonderheiten kennst und sie rechtssicher auslegst, kannst du steuerliche Spielräume optimal nutzen und so die Rentabilität deiner vermieteten Objekte nachhaltig steigern und fundierte Entscheidungen für die Zukunft treffen.
Herstellungs- und Erhaltungsaufwand: Unterschiede & Abschreibung
Wenn du in deine vermietete Immobilie investierst, etwa durch Renovierungen, Sanierungen oder Umbauten, stellt sich aus steuerlicher Sicht eine entscheidende Frage: Handelt es sich dabei um Herstellungsaufwand oder um Erhaltungsaufwand?
Diese Unterscheidung ist wichtig, weil beide Kostenarten unterschiedlich steuerlich behandelt werden. Der Herstellungsaufwand muss über viele Jahre verteilt abgeschrieben werden, der Erhaltungsaufwand kann oft sofort oder in Teilbeträgen abgesetzt werden.
Was ist der Herstellungsaufwand?
Herstellungsaufwand liegt immer dann vor, wenn du:
etwas Neues schaffst, das vorher nicht vorhanden war (z. B. ein Balkon oder eine Garage)
die Wesensart eines Gebäudes änderst (z. B. Dachausbau, Aufstockung)
den Wohnstandard deutlich erhöhst (z. B. Umstellung von Gasheizung auf Wärmepumpe)
oder aus einem nicht bewohnbaren Objekt erstmals einen vermietbaren Wohnraum machst
Beispiel für Herstellungsaufwand:
Du erwirbst eine leerstehende Altbauwohnung, die keine Heizung und kein Bad hat. Die nachträgliche Ausstattung mit Fußbodenheizung, Bad und Einbauküche gilt steuerlich als Herstellung. Du musst die Kosten aktivieren und über die Nutzungsdauer abschreiben.
Diese Kosten sind als aktivierungspflichtiger Herstellungsaufwand zu werten, erhöhen damit die AfA-Bemessungsgrundlage und dürfen nicht sofort als Werbungskosten abgesetzt werden. Stattdessen musst du sie als Teil der Gebäudekosten aktivieren, d.h. der Herstellungsaufwand wird in die AfA-Bemessungsgrundlage aufgenommen und über die Restnutzungsdauer des Gebäudes (in der Regel 67 Jahre bzw. 1,5 %) linear abgeschrieben. Wenn du einen Teil eines Gebäudes nachträglich sanierst oder erweiterst (z. B. den Dachboden zu Wohnraum ausbaust), wird dieser Teil steuerlich wie ein eigenständiges neues Wirtschaftsgut behandelt. Dafür entsteht eine zusätzliche eigene AfA-Bemessungsgrundlage, die separat zur bestehenden Abschreibung des Altbestands berechnet wird.
Wichtig: Davon zu unterscheiden sind sogenannte vorweggenommene Werbungskosten. Sie fallen bereits vor Beginn der Vermietung an (z. B. für Inserate, Beratung, Finanzierung) und sind nicht Teil der AfA, sondern können, sofern sie eben nicht aktivierungspflichtig sind, bereits im Jahr ihrer Zahlung als Werbungskosten geltend gemacht werden, vorausgesetzt es besteht ein klarer Zusammenhang mit der späteren Einkunftserzielung.
Was ist der Erhaltungsaufwand
Wie soeben erläutert, gelten Maßnahmen, die über den ursprünglichen Zustand hinausgehen oder eine wesentliche Substanzverbesserung bewirken, nicht als Erhaltungsaufwand. Erhaltungsaufwand ist alles, was dem Erhalt oder der Wiederherstellung des bestehenden Zustands dient. Dazu gehören insbesondere:
Reparaturen (z. B. defekte Heizung oder Fenster)
Austausch von Installationen (z. B. Elektro- oder Wasserleitungen)
Fassaden- oder Dachsanierungen (ohne Erweiterung)
Malerarbeiten, Bodenbeläge, Standardmodernisierung
Solche Maßnahmen kannst du entweder sofort zur Gänze absetzen oder bei größeren Beträgen verteilen ansetzen. Auch wenn keine gesetzliche Verpflichtung zur Verteilung besteht, kannst du größere Erhaltungsaufwendungen freiwillig auf bis zu 15 Jahre gleichmäßig absetzen. Diese Möglichkeit ist besonders nützlich, wenn du deine Einkünfte glätten möchtest oder in einem bestimmten Jahr bereits hohe steuerpflichtige Einkünfte hast.
Unterschied zwischen Instandhaltung und Instandsetzung
Innerhalb des Erhaltungsaufwands unterscheidet man gewöhnlich nochmals:
Instandhaltung: laufende Maßnahmen zur Pflege und Funktionserhaltung (z. B. Wartung, kleinere Reparaturen)
Instandsetzung: größere Maßnahmen, bei denen beschädigte oder veraltete Teilen etc. ersetzt werden
Für beides gilt, die Kosten können, sofern nicht Herstellung vorliegt, als Werbungskosten im Rahmen der Einnahmen-Werbungskosten-Überschussrechnung abgesetzt werden. Dokumentiere Art, Umfang und Zweck der Arbeiten immer sauber, unbedingt mit Handwerkerrechnungen und Fotos.
Aufbewahrungspflicht von Unterlagen
Auch als private:r Vermieter:in bist du verpflichtet, sämtliche steuerlich relevanten Unterlagen wie Mietverträge, Abrechnungen, Belege zu Ausgaben, Gutachten oder Kreditunterlagen mindestens sieben Jahre bzw. bei Grundstücksveräußerungen bis zum Ablauf der Verjährung der Immobilienertragsteuer aufzubewahren. Diese Frist ergibt sich aus § 132 der Bundesabgabenordnung (BAO). Sie beginnt mit dem Ende des jeweiligen Kalenderjahres, in dem der letzte Eintrag vorgenommen wurde oder das Dokument steuerlich von Bedeutung war. Bei anhängigen Verfahren oder laufenden Prüfungen kann sich die Aufbewahrungsdauer verlängern.
Bewahre deine Unterlagen systematisch auf, idealerweise digital. Das erleichtert nicht nur die Nachweispflicht bei Rückfragen des Finanzamts, sondern auch die laufende Verwaltung deiner Immobilie.
Spezialfall des Erhaltungsaufwand über 15 Jahre
Gemäß gesetzlicher Vorgaben des EStG und geltenden den Vorgaben des Finanzministeriums müssen bestimmte Maßnahmen verpflichtend auf 15 Jahre verteilt werden, wenn:
es sich um eine umfassende Sanierung eines vermieteten Wohngebäudes handelt
die Maßnahme nicht lediglich punktuelle Reparatur, sondern strukturelle Verbesserung darstellt
der Aufwand mehr als 25 % des Gebäudeanteils beträgt
Das betrifft etwa den Austausch der gesamten Haustechnik, die Sanierung des Tragwerks, die thermische Generalsanierung oder kategorieanhebende Maßnahmen.
Wichtig: Diese 15-jährige Verteilungspflicht betrifft nur Wohngebäude. Bei gewerblich genutzten Immobilien kannst du weiterhin Sofortabzug geltend machen, sofern keine Aktivierungspflicht besteht.
Fazit Erhaltungsaufwand und Herstellungsaufwand
Die steuerliche Behandlung deiner Investitionen steht und fällt mit der korrekten Zuordnung als Herstellungs- oder Erhaltungsaufwand. Während Erhaltungsmaßnahmen schnell steuerlich wirksam werden können, sind Herstellungsaufwendungen über Jahre hinweg abzuschreiben.
Je besser du deine Maßnahmen als Vermieter:in im Vorfeld planst und dokumentierst, desto gezielter kannst du deren steuerliche Wirkung gestalten. Und bei größeren Umbauprojekten lohnt sich auf jeden Fall der rechtzeitige Blick in die Steuerberatung.
Ausblick auf Teil 3
Im nächsten Teil der Serie behandelt wir die Umsatzsteuer und ihre Handhabung im Rahmen der Vermietung. Dabei erklären wir dir, welche Optionen es für dich als Vermieter:in gibt, welche Sätze wann zur Anwendung kommen und welchen Spielraum du hast. Ebenso gehen wir auf die Umsatzsteuer im Rahmen der Kleinunternehmerregelung ein und erarbeiten, was es mit der UVA auf sich hat. Darüberhinaus behandeln wir die Immobilienertragsteuer und und ihre Berechnung anhand eines praktischen Beispiels.
Lesetipps
Lies dir auch die anderen Teile dieser Serie durch – so bekommst du einen vollständigen Überblick über alle steuerlich relevanten Themen rund ums Vermieten als Vermieter mit Immobilien im Privatvermögen.
Teil 1: Mieteinnahmen in Österreich versteuern – Was du als privater Vermieter wissen musst
Teil 3: Mieteinnahmen in Österreich versteuern – Was du als Vermieter wissen musst
Teil 4: Mieteinnahmen in Österreich versteuern – Was du als privater Vermieter wissen musst
Du möchtest keine Artikel mehr verpassen?
Melde dich jetzt bei unserem Newsletter an.
Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte wende dich bei rechtlichen Fragen oder individuellen Anliegen an eine qualifizierte Rechtsberatung. Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernommen werden. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung der Informationen entstehen, ist, soweit zulässig, ausgeschlossen. Weitere Hinweise und der vollständige Haftungsausschluss sind im Impressum einsehbar.