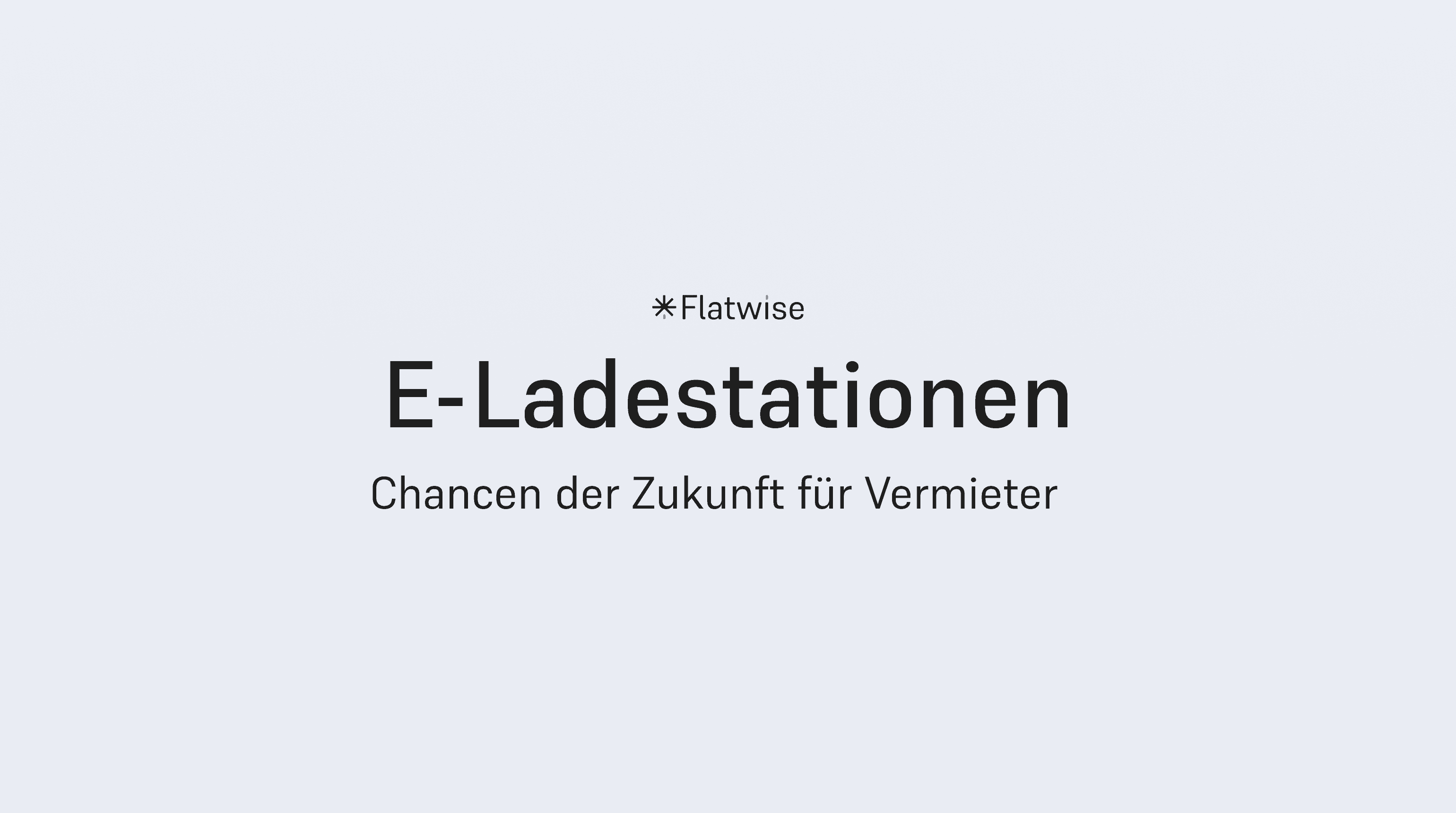Bau
Garagenbau in Österreich: Kosten, Genehmigung und Vermietung
Garage nachträglich bauen und vermieten? Erfahre in Österreichs Kontext alles zu Baurecht, Kosten, Rendite, E-Laden und Verträgen.
Schnellüberblick gefällig?
Du willst nur die häufigsten Fragen & Antworten sehen? Spring direkt zum FAQ am Ende des Artikels.
In vielen Städten und Gemeinden in Österreich sind Parkplätze knapp und das macht Garagenplätze für Mieter:innen zu einem begehrten Gut. Für dich als Vermieter:in kann der nachträgliche Bau von Garagen deshalb gleich doppelt interessant sein: Einerseits schaffst du einen echten Mehrwert für deine Immobilie, andererseits eröffnest du dir eine zusätzliche Einnahmequelle.
Doch bevor du einfach loslegst und den Bagger bestellst, solltest du wissen: Der Garagenbau ist kein kleines Nebenprojekt. Er erfordert eine sorgfältige Planung, genaue Kalkulation und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben. Gleichzeitig lohnt sich der Blick auf die Chancen: Höhere Attraktivität deiner Wohnungen, stabilere Mietverhältnisse und die Möglichkeit, die Immobilie insgesamt im Wert zu steigern.
In diesem Artikel erfährst du, welche Vor- und Nachteile der nachträgliche Garagenbau mit sich bringt, welche Genehmigungen du brauchst, welche Kosten und Ertragsmöglichkeiten realistisch sind und wie du die Garagen in der Praxis erfolgreich vermietest.
Vor- und Nachteile für Vermieter:innen
Der nachträgliche Bau von Garagen klingt im ersten Moment nach einer klaren Win-Win-Situation: Du bietest deinen Mieter:innen zusätzlichen Komfort und generierst selbst neue Einnahmen. In der Praxis lohnt es sich aber, die Sache differenziert zu betrachten.
Vorteile
Ein Garagenplatz erhöht die Attraktivität deiner Immobilie erheblich. Gerade in städtischen Lagen mit knappem Parkraum sind Mieter:innen oft bereit, für einen sicheren Abstellplatz extra zu zahlen. Das kann zu einer längeren Mietdauer, geringerer Fluktuation und stabileren Einnahmen führen. Zudem steigert eine Garage nicht nur die laufenden Einnahmen, sondern auch den Gesamtwert deiner Immobilie ein Faktor, der sich beim späteren Verkauf oder einer Refinanzierung auszahlen kann.
Nachteile
Dem stehen jedoch auch Nachteile gegenüber. Der Bau ist mit erheblichen Kosten verbunden, die sich nicht in jedem Fall schnell amortisieren. Dazu kommt ein gewisser Verwaltungsaufwand, da du die Garagen separat vermieten und Abrechnungen anpassen musst. In manchen Fällen kann auch der Flächenverbrauch oder eine eingeschränkte Nutzung (etwa wegen Bebauungsplänen oder Nachbarrechten) die Wirtschaftlichkeit schmälern. Außerdem bindest du Kapital, das dir an anderer Stelle fehlt, etwa für Sanierungen oder energetische Verbesserungen.
Unterm Strich gilt: Der Garagenbau kann eine kluge Investition sein, wenn Standort, Nachfrage und Baukosten in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Ob es sich für dich lohnt, hängt also stark von der Ausgangssituation deines Objekts ab.
Rechtliche Rahmenbedingungen und Genehmigungen
Bevor du mit der Planung einer Garage loslegst, solltest du dir bewusst sein. dass „Einfach drauflosbauen“ keine Option ist. Es gibt klare Vorgaben, die du unbedingt einhalten musst.
Baurechtliche Genehmigungen
Der Bau einer Garage fällt in der Regel unter die Baubewilligungspflicht. Welche Unterlagen einzureichen sind, hängt vom Bundesland und der Gemeinde ab. Typischerweise brauchst du:
Baupläne eines befugten Planers (z. B. Architekt oder Ziviltechniker)
Nachweise über die Einhaltung von Bauvorschriften (z. B. Brandschutz, Statik)
Zustimmung angrenzender Nachbarn, falls die Garage direkt an die Grundstücksgrenze gesetzt wird
Bebauungsplan und Flächenwidmung
Ob eine Garage überhaupt zulässig ist, hängt auch von der Flächenwidmung und dem örtlichen Bebauungsplan ab. Manche Grundstücke haben Auflagen zur Anzahl von Stellplätzen oder zur maximalen Verbauung. Gerade in dicht bebauten Gebieten können Einschränkungen bestehen. Ein wichtiges Thema sind die Mindestabstände zu Nachbargrundstücken und Gebäuden. Außerdem gelten in Garagen besondere Vorschriften zum Brandschutz, zur Belüftung und zu Fluchtwegen, auch dann, wenn es sich um kleinere Einzelgaragen handelt solltest du immer alle Vorschriften berücksichtigen.
Sonderfälle bei Bestandsgebäuden
Bei Mehrfamilienhäusern kommt noch ein zusätzlicher Aspekt dazu: Wenn du als Vermieter:in den Bau von Garagen planst, betrifft das oft auch die Miteigentümer:innen (z. B. in einer Wohnungseigentumsanlage). In solchen Fällen brauchst du die Zustimmung der Eigentümergemeinschaft oder musst Mehrheitsbeschlüsse einholen.
Der rechtliche Rahmen ist machbar, aber komplex. Kläre frühzeitig mit der Gemeinde und einem Fachplaner, welche Genehmigungen nötig sind, damit es später keine bösen Überraschungen gibt.
Standort- und technische Anforderungen
Die schönste Garage bringt dir als Vermieter:in nichts, wenn sie unpraktisch gelegen oder technisch schlecht umgesetzt ist. Damit dein Projekt langfristig funktioniert und auch bei Mieter:innen auf Interesse stößt, solltest du bei der Planung folgende Punkte im Auge behalten:
Platz und Zufahrt
Eine Garage sollte so geplant sein, dass sie im Alltag bequem und sicher erreichbar ist – nicht nur für Pkw, sondern auch für Lieferfahrzeuge oder Fahrräder. Entscheidend sind eine ausreichende Zufahrtsbreite, gute Rangiermöglichkeiten und klare Sichtverhältnisse. Gerade in Innenstädten oder auf engen Grundstücken kann eine unpraktische Zufahrt schnell zum Ärgernis werden und im schlimmsten Fall die Vermietungsquote negativ beeinflussen.
Statik und Fundament
Ein stabiles Fundament ist für Garagen unverzichtbar, da es Frost- und Feuchtigkeitsschäden zuverlässig verhindert. Besonders bei Doppel- oder Reihenanlagen sowie bei Tiefgaragen sind häufig umfangreichere statische Berechnungen erforderlich. Diese sorgen dafür, dass das Bauwerk dauerhaft standsicher bleibt und Setzungen oder Risse vermieden werden.
Bauvarianten
Fertiggaragen:
Diese Garagen lassen sich schnell montieren, sind oft kostengünstig und besonders einfach errichtet. Dafür aber sind die Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt. Fertiggaragen sind ab ca. 6.000–15.000 € pro Einheit (inkl. Fundament und Aufbau) erhältlich.
Gemauerte Garagen:
Die klassisch gemauerte Garage ist teurer und zeitintensiver, dafür langlebig und optisch oft besser ins Gebäude integrierbar. Für eine Garage mit einem oder zwei Stellplätzen sind je nach Ausstattung und Größe 20.000–35.000 € fällig.
Tiefgaragen:
Diese Art von Garagen bieten eine Lösung bei Platzmangel oder höherwertigem Wohnbau, allerdings mit erheblichem technischem Aufwand sowie Kosten und zusätzlichen Anforderungen an Belüftung, Entwässerung und Brandschutz. Hier steigen die Kosten deutlich und schlagen mit rund 35.000 € pro Stellplatz, abhängig von der Beschaffenheit, zu Buche. Zusätzlich fall noch weitere Kosten für Genehmigungen, Anschlusskosten (Strom, Entwässerung), Planungs- und Architektenhonorare an, diese können bis zu 10–20 % ausmachen.
Carports:
Ein Carport ist eine kostengünstige Alternative zur geschlossenen Garage. Er schützt Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen, bleibt aber nach mindestens einer Seite offen. Dadurch entfallen Kosten für Mauern oder Tore, und die Bauzeit ist relativ kurz. Einfache Modelle sind bereits ab etwa 4.000–8.000 € erhältlich, während hochwertige, individuell geplante Carports (z. B. mit Holz- oder Metallkonstruktion) 10.000–15.000 € oder mehr kosten können.
Freiabstellplätze:
Am günstigsten ist die Anlage eines einfachen Stellplatzes im Freien. Hier fallen im Wesentlichen Kosten für die Flächenbefestigung (z. B. Asphalt, Pflaster oder Rasengittersteine), Markierung und eventuell eine Beleuchtung an. Je nach Material und Aufwand solltest du mit 2.000–5.000 € pro Stellplatz rechnen. Freiabstellplätze sind schnell errichtet und besonders dort interessant, wo der Bau einer Garage nicht möglich oder nicht wirtschaftlich ist. Sie bieten allerdings nur begrenzten Schutz vor Witterung und keinen zusätzlichen Stauraum, lassen sich aber in begehrten Lagen ebenfalls gut vermieten.
Ausstattung und Komfort
Mit der richtigen Ausstattung kannst du eine Garage deutlich attraktiver machen und so sowohl die Vermietbarkeit als auch den Wert deiner Immobilie steigern. Besonders in Zeiten von E-Mobilität und steigender Nachfrage nach zusätzlichem Stauraum lohnt es sich, bei der Planung an Komfort-Extras zu denken.
Entwässerung: Bodenabläufe oder leichte Gefälle vermeiden stehendes Wasser.
Beleuchtung: Eine umfassende Beleuchtung sorgt für Sicherheit und bessere Vermietbarkeit.
Stromanschlüsse: Diese sind heute fast Pflicht, vor allem mit Blick auf die steigende Nachfrage nach E-Mobilität. Eine Ladeinfrastruktur (Wallbox) kann die Attraktivität deiner Garagen zusätzlich erhöhen.
PV- Anlagen: Du kannst deine Garagen mit einer PV-Anlage zur Versorgung von E-Ladenstationen oder der allgemeinen Versorgung mit ausstatten.
Lagerraum: Ein Garagenkomplex kann auch im Lagerräume, z.B. für Reifen oder um einen Radabstellraum erweitert werden. Das schafft zusätzlichen Komfort für deine Mieter:innen und stärkt so die Stellung deiner Liegenschaft am Markt.
Lesetipp: Photovoltaik für Vermieter. Mehr Rendite durch erneuerbare Energien.
Die technischen Details machen oft den Unterschied zwischen „einfach nur Stellplatz“ und „attraktivem Zusatzangebot“. Wer hier mitdenkt, steigert die Vermietbarkeit und den langfristigen Wert sowie die Rendite.
Kosten, Erträge und Wirtschaftlichkeit
Der Bau von Garagen ist für dich als Vermieter:in eine Investition, die gut durchgerechnet sein will. Auf den ersten Blick mögen die Kosten hoch erscheinen, aber Garagen können stabile und langfristige Einnahmemöglichkeiten mit erheblichen Renditenpotential bieten.
Ein Beispiel:
Baukosten für eine Fertiggarage: 12.000 €, monatliche Mieteinnahmen: 110 € (abhängig nach Region), jährliche Einnahmen: 1.320 €
Hieraus ergibt sich eine Amortisation von ca. 9 Jahre, ohne Finanzierungskosten. Mit Stromanschluss oder Wallbox kannst du die Miete oft um 30–50 € monatlich erhöhen und die Amortisationszeit entsprechend verkürzen.
Mietpreise und Ertragsmöglichkeiten
Die Mietpreise und Ertragsmöglichkeiten für Garagen und Stellplätze variieren stark je nach Lage. In kleineren Städten lassen sich in der Regel zwischen 60 und 100 Euro pro Stellplatz erzielen. In Ballungsräumen wie Wien oder Salzburg liegen die Mieten deutlich höher, hier sind 120 bis 180 Euro üblich, mit zusätzlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sogar noch mehr. Grundsätzlich bleibt die Nachfrage nahezu überall stabil, da Parkraum weiterhin knapp ist.
Steuerliche Aspekte
Bei der Vermietung von Garagen sind einige steuerliche Rahmenbedingungen zu beachten. Da Garagen als Gebäudeteile gelten, können sie über einen Zeitraum von 40 bis 50 Jahren abgeschrieben werden (AfA). Zudem unterliegt die Vermietung von Garagen grundsätzlich der Umsatzsteuer in Höhe von 20 %, auch wenn die Wohnungsvermietung an sich steuerfrei ist. Dieser Punkt sollte in der Kalkulation unbedingt berücksichtigt werden. Die erzielten Mieteinnahmen aus Garagen zählen steuerlich zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung und müssen entsprechend versteuert werden.
Mit solider Kalkulation und guter Lage können Garagen eine attraktive Ergänzung deines Immobilienportfolios sein. Besonders spannend wird es, wenn du E-Mobilität mitdenkst – das steigert nicht nur die Einnahmen, sondern macht deine Immobilie auch zukunftssicher.
Vermietungspraxis
Wenn die Garage steht, beginnt für dich die eigentliche Arbeit als Vermieter:in. Denn ein sauber aufgesetzter Mietvertrag, die richtige Versicherung und ein klarer Plan für die Verwaltung sorgen dafür, dass deine Investition langfristig problemlos läuft.
Mietvertrag für Garagen
Garagenmietverträge sind rechtlich von Wohnraummietverträgen zu unterscheiden, da sie nicht dem Mietrechtsgesetz (MRG) unterliegen, sondern als Nutzungsverträge gelten. Das verschafft Vermietern mehr Flexibilität, erfordert jedoch zugleich klare und eindeutige Regelungen. Ein schriftlicher Vertrag ist dringend zu empfehlen, auch wenn mündliche Vereinbarungen grundsätzlich gültig wären. Hinsichtlich der Laufzeit kannst du zwischen befristeten und unbefristeten Verträgen wählen; in der Praxis haben sich Kündigungsfristen von rund drei Monaten etabliert. Wichtig ist zudem eine transparente Darstellung der Nebenkosten, etwa für Strom (Beleuchtung oder E-Ladestationen), Entwässerung oder die allgemeinen Betriebskosten der Anlage. Ebenso sollte die Haftung klar geregelt sein: Der Vermieter haftet in der Regel nicht für abgestellte Fahrzeuge oder deren Inhalte.
Lesetipp: Hierzu empfehlen wir den Artikel Mietvertrag richtig aufsetzen – viele Tipps gelten auch für Garagen.
Versicherung und Unterhalt
Für Garagen ist in der Regel eine Gebäudeversicherung vorhanden, die Schäden am Bauwerk abdeckt. Dennoch solltest du genau prüfen, ob auch Risiken wie Brand, Sturm oder Vandalismus eingeschlossen sind. Bei größeren Anlagen, etwa Tiefgaragen, empfiehlt sich zusätzlich eine Haftpflichtversicherung, um dich gegen mögliche Schadensersatzforderungen abzusichern. Der laufende Unterhalt hält sich meist in Grenzen: Wichtig ist eine regelmäßige Kontrolle von Beleuchtung, Toren und Entwässerungssystemen. So lassen sich kleinere Mängel frühzeitig erkennen und kostspielige Reparaturen vermeiden.
Integration von E-Ladestationen
Elektromobilität ist ein echter Zukunftsfaktor. Wenn du Ladepunkte einplanst, musst du an mehr denken als nur die Wallbox:
Abrechnung: Stromkosten dürfen nicht pauschal auf alle Mieter:innen verteilt werden. Es braucht ein klares Mess- und Abrechnungssystem (z. B. separate Zähler oder Lade-Apps).
Lastmanagement: Bei mehreren Ladepunkten musst du sicherstellen, dass die Stromversorgung nicht überlastet wird. Moderne Systeme regeln die Ladeleistung automatisch.
Förderungen: Der Staat unterstützt Ladeinfrastruktur in Mehrparteienhäusern – eine Investition, die sich doppelt lohnt.
Wichtiger Hinweis: Selber wenn du beim Bau noch keine Wall-Boxen anbringen solltest, ist es wichtig den Einbau bereits vorzusehen und die dementsprechenden Anschlüsse, Leitungen etc. zu berücksichtigen. Das sparet später Zeit und Geld.
Mit klaren Verträgen, solider Absicherung und dem Blick auf die E-Mobilität holst du aus deiner Garage mehr heraus als nur einen Abstellplatz. Richtig gemanagt wird sie zum wertvollen Zusatzbaustein deines Immobilienportfolios.
Garagen als Ergänzung zur Wohnraumvermietung
Der nachträgliche Bau von Garagen kann für dich als Vermieter:in eine lohnende Ergänzung deines Immobilienportfolios sein. Garagen bieten stabile Einnahmen, erhöhen den Wert deiner Liegenschaft und machen dein Objekt für Mieter:innen attraktiver. Gleichzeitig sind sie aber kein Selbstläufer, denn Baukosten, rechtliche Rahmenbedingungen und laufender Unterhalt erfordern eine sorgfältige Planung.
Wenn du die rechtlichen Vorgaben beachtest, die Kosten realistisch kalkulierst und von Beginn an eine klare Vermietungsstrategie entwickelst, können Garagen zu einem soliden, langfristigen Investment werden mir hohem Renditenpotential werden. Entscheidend ist, dass du den Bau nicht nur als zusätzliche Einnahmequelle, sondern auch als Verpflichtung siehst – gegenüber deinen Mieter:innen, den Behörden und deiner eigenen Rentabilität.
Kurz gesagt: Wer gründlich plant, rechtlich abgesichert vorgeht und marktorientiert kalkuliert, schafft mit Garagen ein Plus für die Immobilie und die eigene Rendite.
Häufig gestellte Fragen zu diesem Thema
Hier findest du alle Antworten auf die wichtigsten Fragen zu diesem Thema.
Du möchtest keine Artikel mehr verpassen?
Melde dich jetzt bei unserem Newsletter an.
Die Inhalte dieses Artikels dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Rechtsberatung im Einzelfall dar. Bitte wende dich bei rechtlichen Fragen oder individuellen Anliegen an eine qualifizierte Rechtsberatung. Trotz sorgfältiger Recherche kann keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernommen werden. Eine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung der Informationen entstehen, ist, soweit zulässig, ausgeschlossen. Weitere Hinweise und der vollständige Haftungsausschluss sind im Impressum einsehbar.